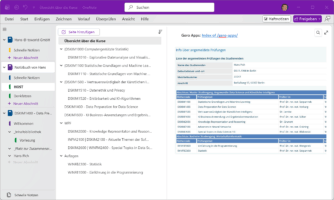Analoge Tafel, digitales Thema
Heute möchte ich von einer ganz besonderen Vorlesung berichten:
Statistische Grundlagen des Maschinellen Lernens.
Ein Fach, das schon vom Namen her nach moderner Computertechnik klingt – und dann doch erstaunlich klassisch daherkommt.
In dieser Veranstaltung geht es darum zu verstehen, wie Maschinelles Lernen funktioniert. Also nicht nur, wie man es anwendet, sondern was rechnerisch und statistisch eigentlich passiert, wenn ein Algorithmus „lernt“.

Wie Maschinen lernen, Muster zu erkennen
Vereinfacht gesagt:
Beim Maschinellen Lernen versucht ein Programm, aus vielen Daten herauszufinden, wie diese miteinander in Beziehung stehen.
Man kann sich das wie ein Experiment im Physikunterricht vorstellen:
Man trägt Messwerte in ein Diagramm ein und sucht dann nach einer Formel, die möglichst genau beschreibt, was passiert.
In einfachen Fällen klappt das noch durch bloßes Hinschauen. Aber wenn die Zusammenhänge komplexer werden – etwa, wenn man mehrere Einflussgrößen gleichzeitig hat – hilft das Hinschauen allein nicht mehr weiter.
Hier kommt das Maschinelle Lernen (ML) ins Spiel:
Das System nimmt anfangs eine mögliche Funktion an und passt deren Parameter Schritt für Schritt an, bis die Abweichungen zwischen berechneten und tatsächlichen Werten minimal sind. So lernt es – iterativ, geduldig und mit mathematischer Präzision.
Statistik zum Anfassen
In unserer Vorlesung geht es also genau um diese Prozesse:
Wie man sie mathematisch beschreibt, wie man sie berechnet – und warum Statistik dabei so entscheidend ist.
Wer jetzt noch nicht so genau weiß, wovon ich rede, hat zwei Optionen:
entweder selbst in die Vorlesung kommen oder mich am Ende des Semesters noch einmal fragen – dann habe ich vielleicht anschaulichere Beispiele.
Tradition trifft Moderne: Handschrift statt Folienflut
Und jetzt kommt das Überraschende:
Diese Vorlesung ist weitgehend analog.
Unser Dozenty schreibt die Inhalte live – mit Kreide oder Stift, direkt vor Ort. Und wir Studys? Wir schreiben mit.
Das klingt fast altmodisch, hat aber seinen Reiz. Wir können jederzeit Fragen stellen, diskutieren und sehen, wie sich die Gedanken Zeile für Zeile entwickeln. Das hilft dem Verständnis – und ist gleichzeitig ein gutes Training für Hände, die das viele Mitschreiben gar nicht mehr gewohnt sind.
Nicht alle Studys waren von dieser Methode sofort begeistert. Zuhören, mitschreiben und gleichzeitig mitdenken ist schließlich kein Selbstläufer. Aber gerade darin liegt vielleicht der Wert: Konzentration, Verlangsamung, echtes Mitdenken statt Folienkonsum. Und wenn die Hand verkrampft, kann man ja auch noch mit einer Zwischenfrage für etwas entlasung sorgen.
Das Bild ist übrigens von unsplash.com, da ich mich nicht traue meine eigene Mitschrift zu veröffentlichen (siehe unten).
Déjà-vu mit Folienrolle
Mich hat diese analoge Lehrform sofort an eine andere Zeit erinnert – an mein erstes Studium an der Uni Passau, genauer gesagt an Prof. Hahn. Bei ihm habe ich ein Semester lang Firmwareprogrammierung gehört, also Programmierung auf der untersten Ebene, in Assembler. Viel ist davon inhaltlich nicht hängen geblieben, aber die Art seiner Vorlesung habe ich F vollgeschrieben, das Thema erklärt – und eine Rolle verbraucht.
Rückblickend war das schon ein kleines Kunstwerk.
Ein bisschen irre, ja – aber auch faszinierend.
Analoge Handschrift, digitale Zeiten
Ich bin gespannt, ob ich in 30 Jahren genauso nostalgisch auf unsere heutige Vorlesung zurückblicken werde. Vielleicht ist die handgeschriebene Vorlesung dann längst ein Museumsstück – oder eine wiederentdeckte Lerntechnik. Und ich kann meinen Enkeln davon erzählen und sie werden dann die Augen verdrehen, weil ich das schon Tausendmal erzählt haben werde.
Eine Gemeinsamkeit mit unserem schreibenden Dozenty habe ich übrigens schon festgestellt:
Die Handschrift.
Sie ist nicht immer leicht zu entziffern – meine eigene übrigens auch nicht.
Wenn ich meine Mitschriften später noch einmal durchgehe, stoße ich regelmäßig auf Wörter, die nur ich erfunden haben kann. Diesen kleinen Schönheitsfehler trage ich allerdings schon seit der Schulzeit mit mir herum. Das wird sich wohl auch nicht mehr ändern.